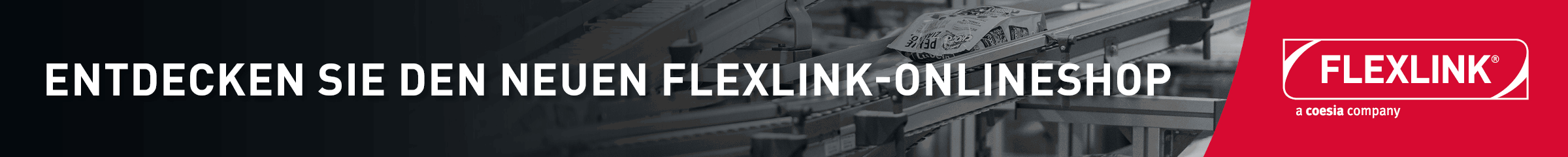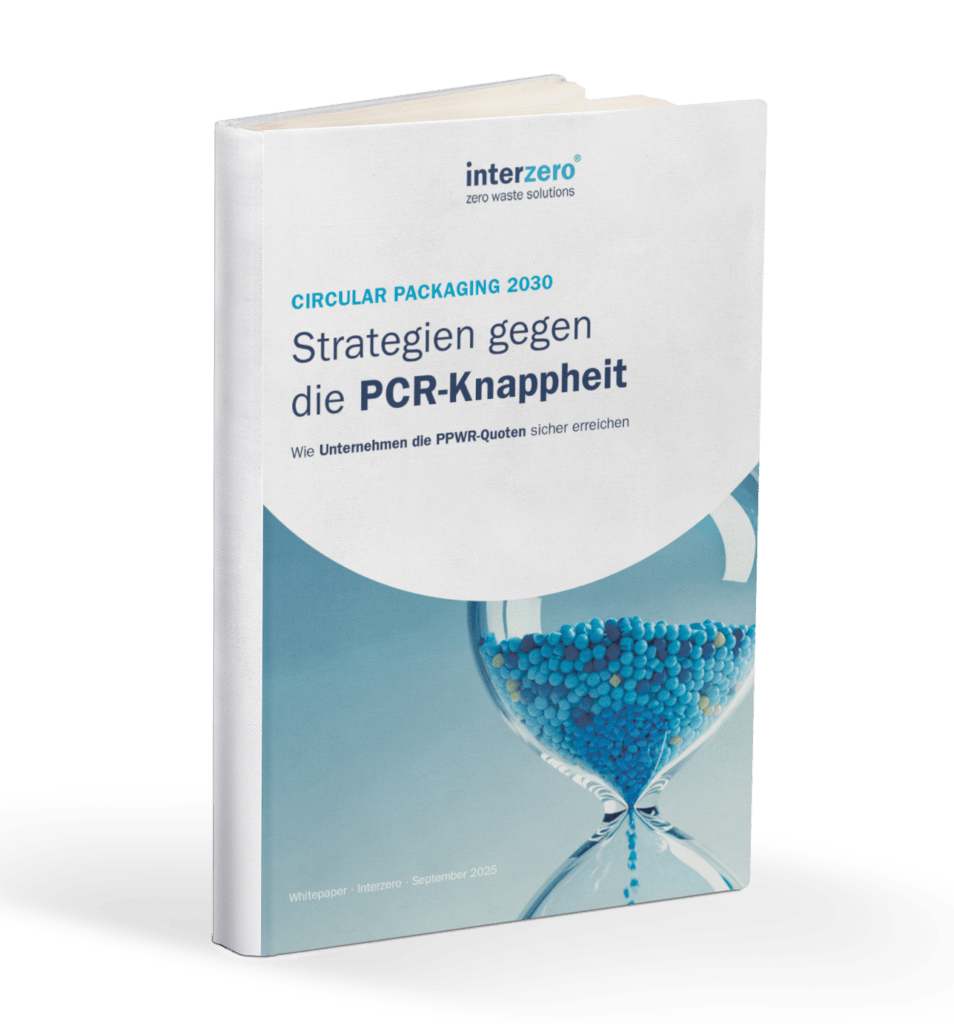Die Zeit drängt: Ab 2030 gelten EU-Quoten für Rezyklate – doch schon heute fehlt es an hochwertigem PCR. Eine neue Studie im Auftrag von Interzero zeigt eine drohende Lücke von rund 1 Mio. Tonnen. Wer jetzt nicht handelt, riskiert hohe Kosten, Engpässe und Strafen. Wie Unternehmen gegensteuern und sich Wettbewerbsvorteile sichern können.
Die neue Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) der EU verpflichtet alle Inverkehrbringer von Verpackungen ab 2030 zu verbindlichen Mindesteinsatzquoten für Post-Consumer-Rezyklate (PCR). Doch schon heute ist hochwertiges PCR knapp und teuer. Eine von Interzero bei bp consultants der Berndt+Partner Group beauftragte Studie zeigt: Selbst unter optimistischen Annahmen wird 2030 eine Versorgungslücke von rund 1 Million Tonnen bestehen – mit gravierenden Folgen für Markenhersteller und Verpackungsproduzenten. Wer erst in wenigen Jahren reagiert, riskiert nicht nur Strafen, sondern auch Produktionsausfälle und Preissteigerungen.
Um eine fundierte Analyse der aktuellen Marktsituation zu ermöglichen, wurde die unabhängige Beratungsgesellschaft mit der Erstellung eines Lageberichts beauftragt. Die Studie untersucht mögliche Ursachen einer zukünftigen PCR-Knappheit, analysiert die Auswirkungen regulatorischer Vorgaben und identifiziert mögliche Lösungsstrategien. Dazu wurden aktuelle Marktdaten auf europäischer Ebene, Experteneinschätzungen sowie Entwicklungen entlang der Wertschöpfungskette berücksichtigt.

Laut der Studie sind 80 % der befragten Expert*innen überzeugt, dass die PPWR-Quoten wie geplant umgesetzt werden – unabhängig von der Materialverfügbarkeit. Gleichzeitig berichten viele Unternehmen bereits heute, lange nach lebensmitteltauglichem PCR suchen zu müssen und dafür einen hohen Preis zu zahlen.
Fünf strukturelle Ursachen treiben die Knappheit:
- Designbarrieren: komplexe Multilayer, Farbträger und Additive verhindern hochwertiges Recycling.
- Sortierqualität: unzureichende Trennbarkeit und falsche Entsorgung bremsen den Stoffstrom.
- Limitierte Recyclingkapazitäten: insbesondere für Food-Grade-Materialien.
- Preiswettbewerb mit Neuware: günstige Virgin-Kunststoffe untergraben die PCR-Nachfrage.
- Branchenübergreifende Konkurrenz: auch Automotive, Bau und Elektronik beanspruchen die knappen Mengen.
Das PCR-Gap 2030 – rund eine Million Tonnen fehlen
Die Analyse zeigt: Selbst bei steigenden Quoten im chemischen Recycling und höheren mechanischen Recyclingraten bleibt eine massive Lücke. Besonders kritisch:
- Polypropylen (PP): in Food und Kosmetik stark nachgefragt, aber selten lebensmitteltauglich.
- LDPE & Multilayer aus den haushaltsnahen Abfallströmen: technisch schwer zu recyceln.
- Food-Grade-PCR: unterreguliert, unterzertifiziert, unterproduziert.
Zur Schließung der Lücke wären etwa zehn neue Großanlagen nötig, von denen aktuell keine im industriellen Maßstab betriebsbereit ist. Während das mechanische Recycling heute die Hauptquelle für PCR darstellt, stößt es bei komplexen Strukturen an Grenzen. Chemisches Recycling kann als Ergänzung zum mechanischen Recycling langfristig helfen, steckt aber noch in der Aufbauphase.
Risiken für Markenhersteller – und Chancen für First Mover
Markenhersteller stehen angesichts der PCR-Knappheit vor einer doppelten Herausforderung: Sie müssen nicht nur die verbindlichen PPWR-Quoten erfüllen, sondern gleichzeitig ihre Versorgungssicherheit gewährleisten und Kostenrisiken minimieren. Wird die Quote nicht erreicht, drohen nicht nur Strafen, die noch in den delegierten Rechtsakten ausformuliert werden, sondern auch erhebliche Imageschäden. Ohne langfristig gesicherte Zugänge zu hochwertigem PCR können Produktionsstopps Realität werden – mit Folgen für Lieferketten und Kundenbeziehungen. Gleichzeitig ist absehbar, dass sich die Preise bei knappen Ressourcen deutlich nach oben bewegen werden. Unternehmen, die frühzeitig handeln, sichern sich dagegen stabile Mengen zu kalkulierbaren Konditionen und können ihre Nachhaltigkeitsleistung als Wettbewerbsvorteil ausspielen. Das zeigt das Beispiel eines deutschen Molkereibetriebs, der bereits 2022 einen Sieben-Jahres-Vertrag mit festen PCR-Mengen, Preisformel und Herkunftsnachweis abgeschlossen hat. Während viele Wettbewerber 2024 mit Versorgungsproblemen kämpften, lief seine Produktion ohne Unterbrechung weiter – und das zu konstanten Kosten.
Um die Versorgung mit Post-Consumer-Rezyklaten langfristig zu sichern, sollten Unternehmen jetzt eine klare Strategie entwickeln und umsetzen. Ein zentraler Hebel liegt im konsequenten Design for Recycling: Verpackungen müssen so gestaltet werden, dass sie im Recyclingprozess effizient verwertet werden können. Dazu gehört auch, komplexe Multilayer-Konstruktionen schrittweise durch recyclingfähige Monomaterialien zu ersetzen. Parallel dazu ist es entscheidend, sich nicht allein auf kurzfristige Ausschreibungen zu verlassen, sondern verlässliche Lieferpartnerschaften mit Recyclern und dualen Systemen aufzubauen – idealerweise über langfristige Verträge mit klar definierten Qualitäts- und Herkunftsstandards. Auch Investitionen in neue Technologien wie das chemische Recycling sollten frühzeitig geprüft werden, wenngleich deren realer Mengeneffekt bis 2030 realistisch eingeschätzt werden muss. Transparente Kennzahlen helfen, Fortschritte messbar zu machen und Ziele im Blick zu behalten. Ebenso wichtig ist es, klare Verantwortlichkeiten im Unternehmen zu verankern, damit die Umsetzung von Maßnahmen nicht im Tagesgeschäft untergeht, sondern Teil einer verbindlichen Roadmap wird.

Der Weg nach vorne
Die kommenden Monate werden entscheidend dafür sein, ob Unternehmen 2030 nicht nur gesetzeskonform, sondern auch wettbewerbsfähig agieren können. Die Analyse macht deutlich: Warten ist keine Option, denn jeder verlorene Monat verschärft die Abhängigkeit von knappen Ressourcen und erhöht Kostenrisiken. Wer jetzt handelt, profitiert gleich mehrfach – durch frühzeitig gesicherte Materialmengen, stabile Preise, eine gestärkte Position im Wettbewerb und eine klare Nachhaltigkeitsbotschaft gegenüber Kunden, Investoren und Öffentlichkeit. Dabei geht es nicht nur um technische Anpassungen, sondern um einen strategischen Wandel entlang der gesamten Wertschöpfungskette: vom Design der Verpackung über die Materialauswahl bis zu langfristigen Lieferverträgen und der Integration von Kreislaufwirtschaftszielen in die Unternehmensstrategie.
Die im Rahmen der PPWR vorgesehenen Recyclingquoten und Mindestanteile an Rezyklat sind zentrale Stellschrauben für den Aufbau einer echten zirkulären Kreislaufwirtschaft. Sie setzen verbindliche Ziele, die Investitionssicherheit schaffen und den Ausbau innovativer Recyclingtechnologien vorantreiben.
Eine Abschwächung dieser Vorgaben würde nicht nur bestehende Fortschritte gefährden, sondern auch dringend notwendige Investitionen in Infrastruktur, Technologie und Märkte ausbremsen. Vielmehr gilt es, die Quoten als Impulsgeber zu verstehen – für neue Geschäftsmodelle, für den Ausbau geschlossener Materialkreisläufe und für eine ressourcenschonende Zukunft.
Interzero begleitet Unternehmen bei diesem Wandel mit fundierten Analysen, der Optimierung von Verpackungen nach Recyclingkriterien, dem gezielten Sourcing von PCR-Materialien und der Entwicklung individueller Roadmaps zur Erfüllung der PPWR-Anforderungen.
Whitepaper zur Studie
Das vollständige Whitepaper zur Studie „Circular Packaging 2030 – Strategien gegen die PCR-Knappheit“ enthält detaillierte Marktzahlen und Handlungsempfehlungen und steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.
packaging journal 4/2025
Dieser Artikel ist im packaging journal 4/2025 (September) erschienen.
e-Paper
online lesen