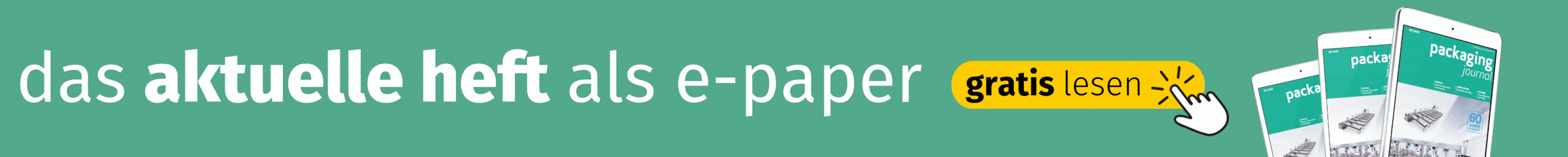In der Schweiz ist die Wiederverwertung von Wertstoffen gerade im Verpackungsbereich mehrheitlich durch nichtgewinnorientierte Recyclingsysteme organisiert. Wie diese Systeme finanziert sind, warum diese Organisation sinnvoll ist und inwiefern sich die politischen Rahmenbedingungen in Zukunft ändern könnten, zeigt die Dachorganisation Swiss Recycle mit ihrer neuen Co-Geschäftsleitung auf.
Seit 1970 hat sich die jährliche Produktion von Siedlungsabfall aus Schweizer Haushalten mehr als verdoppelt: von 309 auf 698 Kilogramm pro Person. Diese Zunahme ist unter anderem auf das Wirtschaftswachstum zurückzuführen. Doch im selben Zeitraum hat nicht nur die Abfallmenge zugenommen, sondern hat sich auch die Schweizer Gesetzgebung derart verändert, dass sie die Separatsammlung und das Recycling bis heute maßgeblich beeinflusst.
Mit dem Umweltschutzgesetz (USG) von 1983 wurde die folgenden, für die Separatsammlung wichtigen Grundsätze festgelegt: Abfälle müssen so weit wie möglich verwertet und umweltverträglich sowie, wenn durchführbar und sinnvoll, im Inland entsorgt werden. Das geht weit über den Verpackungssektor hinaus.
In den 1990er-Jahren entwickelte sich das Recycling in der Schweiz rasant weiter, und zahlreiche Systeme bzw. Branchenorganisationen wie beispielsweise PET-Recycling Schweiz im Jahr 1991 wurden ins Leben gerufen. Diese sogenannten Recyclingsysteme zeigten sich durchgehend verantwortlich für die Separatsammlung, den Transport und die Verwertung von unterschiedlichen Wertstoffen. Im selben Zeitraum wurde die übergeordnete Dachorganisation Swiss Recycle (damals noch Swiss Recycling) gegründet und nimmt seither eine wichtige Rolle in der Sensibilisierung, Vernetzung und Wissensvermittlung rund um Recycling und Kreislaufwirtschaft in der Schweiz ein.
Unterschiedliche Finanzierungsmodelle
Je nach Wertstoff werden die Recyclingsysteme nach unterschiedlichen Modellen finanziert. Bei Glasflaschen beispielsweise wird von einer vorgezogenen Entsorgungsgebühr (VEG) gesprochen. Diese beschreibt eine Gebühr, die sich auf eine gesetzliche Grundlage stützt und beim Inverkehrbringen eines Produkts mit dem Kaufpreis erhoben wird, um die Kosten für die spätere Entsorgung bzw. Wiederverwertung zu decken.

Der vorgezogene Recyclingbeitrag bei Aludosen, Weiß- und Stahlblech oder PET-Getränkeflaschen hingegen entspricht einem Preiszuschlag, der auf den Stufen Produzent, Importeur oder Handel erhoben wird und den Finanzierungsbedarf für das Recycling des betreffenden Produkts deckt. Dieser sogenannte VRB wird meist auf den Verkaufspreis des Getränks aufgeschlagen.
Das bedeutet beispielsweise für einen Schweizer Importeur, dass er auf importiertes Bier in Glasflaschen aus Deutschland eine vorgezogene Entsorgungsgebühr bezahlen muss. Die Daten für diese Verrechnung werden bei der Zolldeklaration gesammelt.
Neben den vorfinanzierten Systemen werden die Sammlung und Entsorgung von Materialien wie Altpapier hingegen durch Rahmenverträge mit den Abnehmern geregelt, die der sammelnden Gemeinde einen Erlös für das Material garantieren. Vereinzelt werden in Gemeinden auch Sammlungen für Korken oder Styropor kostenlos angeboten und von Recyclingunternehmen finanziert.
Revision des Schweizer Umweltschutzgesetzes
Inzwischen hat die Schweizer Politik entschieden, noch einen Schritt weiter in Richtung Kreislaufschließung zu gehen. National- und Ständerat haben am 15. März 2024 daher eine Änderung des Umweltschutzgesetzes (USG) beschlossen, die durch verschiedene politische Vorstöße ins Rollen gebracht wurde.
Mit der vorgesehenen Änderung des USG wird der Grundsatz der Schonung der Ressourcen und der Stärkung der Kreislaufwirtschaft im Gesetz verankert. Das USG wird zudem an weiteren Stellen und dabei insbesondere im Kapitel zum Abfallrecht ergänzt. Neu hält nArt. 30d USG klar fest, dass Abfälle primär der Wiederverwendung oder einer stofflichen Verwertung zugeführt werden müssen.
Neu sieht das USG zudem eine Lockerung des Siedlungsabfallmonopols vor. Gestützt auf nArt. 31b Abs. 4 USG, kann der Bundesrat Siedlungsabfälle bezeichnen, die freiwillig und konzessionsfrei durch private Anbieter gesammelt werden dürfen. Mit dieser Liberalisierung sollen entsprechende Geschäftsmodelle gefördert und kann die Verwertung der Abfälle verbessert werden. Dadurch wird beispielsweise für Gemischt-Kunststoffe (Plastik) und Getränkekarton eine höhere Recyclingquote erwartet. Belastbare Zahlen gibt es derzeit dazu noch nicht.
Einfluss der PPWR auf die Schweizer Verpackungsbranche
Doch nicht nur die Revision des Umweltschutzgesetzes, sondern auch neue Regulationen aus dem europäischen Raum haben Einfluss auf die Schweizer Recyclinglandschaft. Am 11. Februar 2025 trat die neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR) in Kraft, die tiefgreifende Veränderungen mit Auswirkungen auf Design, Materialien, Rücknahme und Datenpflichten von Verpackungen mit sich bringt.
So werden beispielsweise bestimmte Einwegverpackungen aus Kunststoff wie Hoteltoilettenartikel verboten sowie Mindestrezyklatanteile für Verpackungen mit Kunststoffanteilen (je nach Produkt zehn bis 30 Prozent) oder Reduktionsziele (fünf Prozent bis 2030) darin definiert. Die Rezyklierbarkeit von Verpackungen gilt dabei als Voraussetzung: Nur noch Verpackungen, die recycelbar sind, dürfen in der EU in Verkehr gebracht werden. Bis 2028 folgen die Veröffentlichung von Design for Recycling-Guidelines.
Die Anforderungen für die technische Dokumentation und Konformitätserklärung sind dabei sehr anspruchsvoll, sollen aber auch einen fairen Wettbewerb schaffen. Die PPWR stellt damit weit mehr als nur neue Quoten in den Raum: Sie setzt auf Systemwandel, Datenqualität und Verantwortungsübernahme entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Ob als Exporteure, durch Lieferkettenbeziehungen oder durch regionale Nähe: Schweizer Unternehmen sind von diesen Änderungen betroffen. Deshalb gilt es, sich vorzubereiten, die Kreislauffähigkeit der eigenen Produkte zu prüfen und zu verbessern sowie Datenstrukturen auf den Prüfstand zu stellen.
Neue Co-Geschäftsleitung für 360-Grad-Kreislaufwirtschaft
Während die EU vermehrt auf quantitative Ziele setzt, sind in der Schweiz bislang nur wenige Quoten definiert. Das wird jedoch nicht als Nachteil empfunden: Was es braucht, sind ganzheitliche Zielsetzungen und den Rahmen durch die Politik. Die Branche muss diese dann entsprechend umsetzen.
Und die Branche liefert: Die Recyclingsysteme bzw. Branchenorganisationen ermöglichen eine koordinierte, ganzheitliche Umsetzung der Kreislaufschließung. Bewährte Systeme nach erweiterter Produzentenverantwortung (EPR), wie beispielsweise die im Bereich der PET-Getränkeflaschen, zeigen, wie ein Kreislauf ganzheitlich geschlossen werden kann.

Swiss Recycle, die Dachorganisation der Schweizer Recyclingsysteme, setzt sich sowohl in wirtschaftlicher, ökologischer als auch gesellschaftlicher Hinsicht ganzheitlich für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft in der Schweiz ein. Zusammen mit ihren Mitgliedern und Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette realisiert die Organisation Synergien und entwickelt zukunftsgerichtete Lösungen für eine Optimierung der Separatsammlung, des Recyclings und der Kreislaufschließung in der Schweiz.
Seit März 2025 haben Rahel Ostgen und Viviane Pfister gemeinsam die Geschäftsleitung von Swiss Recycle übernommen. Beide waren als Kolleginnen schon länger in der Organisation tätig, und sie freuen sich, diese neue Herausforderung gemeinsam anzupacken. „Wir sind mit Hochdruck daran, unsere Vision von 360-Grad-Kreislaufwirtschaft weiter zu verfolgen. Dazu möchten wir uns in Zukunft nicht nur klarer als übergeordnetes Kompetenzzentrum positionieren, sondern auch unsere Tätigkeiten in den Bereichen Sensibilisieren, Wissen, Vernetzen und Umsetzen auf dieses Ziel fokussieren“, zeigt sich Viviane Pfister motiviert.
Zudem seien auch Digitalisierung und Effizienzsteigerung aktuelle Schlüsselworte bei Swiss Recycle. „Das Interesse an Recycling und Kreislaufwirtschaft ist in den letzten Jahren stets gestiegen, und durch effiziente Prozesse und Ressourcen können wir dieser Nachfrage künftig noch besser gerecht werden“, ergänzt Rahel Ostgen.