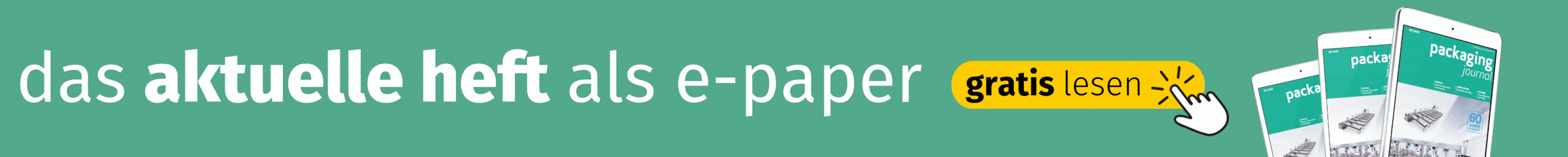Die sechste Verhandlungsrunde zum globalen UN-Plastikabkommen ist ergebnislos zu Ende gegangen. Rund 180 Staaten konnten sich nicht auf einen Vertragstext für ein weltweit verbindliches Regelwerk gegen Plastikverschmutzung einigen. Wie es weitergeht, ist zunächst unklar.
Die Industrie drängt auf einen fokussierten Neustart. Plastics Europe und die deutsche Initiative „Wir sind Kunststoff“ betonen unisono, dass ein globales Abkommen nur dann Wirkung entfalten könne, wenn es die Kreislaufwirtschaft konsequent ins Zentrum rückt. Weltweit haben noch immer 2,7 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer funktionierenden Abfallwirtschaft – ein Kernproblem, das nicht allein durch Recyclingquoten gelöst werden kann. Gefordert sind verpflichtende nationale Aktionspläne, Investitionen in Sammel- und Sortierstrukturen sowie internationale Mechanismen zur erweiterten Herstellerverantwortung.
Umweltorganisationen wie Greenpeace, der WWF und die Deutsche Umwelthilfe kritisieren das Scheitern der Verhandlungen, warnen aber auch vor einem „faulen Kompromiss“.
„Die Auswirkungen der Plastikkrise werden weiterhin massiv unterschätzt. Um das Problem zu lösen, braucht es in Zukunft eine viel größere Aufmerksamkeit, auch auf höchster politischer Ebene. Trotzdem: Ein schwaches Abkommen wäre schlimmer als keines – es würde Stillstand als Fortschritt verkaufen. Ein wirksames Abkommen muss klare Ansagen machen: Plastikproduktion reduzieren, gefährliche Chemikalien und unnötiges Einwegplastik verbieten, Mehrweg fördern und den globalen Süden fair bei den Kosten unterstützen.“
Moritz Jäger-Roschko, Plastikexperte von Greenpeace
Nach dem vorerst gescheiterten globalen Plastikabkommen mahnen auch der BDE und der europäische Entsorgerverband FEAD mehr politisches Engagement für das Kunststoff-Recycling an. Die Verbände verlangen, dass Deutschland die EU-Abgabe auf nicht recycelte Kunststoffverpackungen gezielt zur Förderung von Rezyklaten einsetzt und das steuerliche „Kunststoffprivileg“ bendet, wonach für den in der Kunststoffproduktion eingesetzten fossilen Rohstoff keine Mineralölsteuer gezahlt werden muss. Nur mit fairen Wettbewerbsbedingungen zwischen Neuplastik und Recyclingmaterial könne die Kreislaufwirtschaft gestärkt und die weltweite Plastikverschmutzung wirksam bekämpft werden.
Für die Verpackungsindustrie ist das Thema existenziell. Schon heute macht Verpackungsmaterial einen erheblichen Anteil der weltweiten Kunststoffproduktion aus, mit steigender Tendenz. Innovative Lösungen für Design-for-Recycling, Mehrweg-Modelle und hochwertige Rezyklate gelten daher als Schlüsseltechnologien. Gleichzeitig stehen Unternehmen im Wettbewerb: Nur mit klaren, international abgestimmten Rahmenbedingungen lässt sich ein fairer Markt für nachhaltige Verpackungen etablieren.
Die EU gilt weiterhin als Vorreiter. Mit ambitionierten Strategien zur Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität bis 2050 setzt sie Standards, an denen sich andere Märkte orientieren könnten. Doch ohne ein globales Regelwerk drohen Wettbewerbsverzerrungen. Vertreter der Branche warnen: Nationale Alleingänge allein werden nicht ausreichen, um die weltweite Plastikflut einzudämmen.
Das Scheitern von Genf ist somit nicht nur Rückschlag, sondern auch Auftrag. Politik, Industrie und Zivilgesellschaft sind gefordert, den Verhandlungsprozess entschlossen wieder aufzunehmen – damit Verpackungen künftig nicht als Abfallproblem, sondern als Rohstoff im Kreislauf verstanden werden.
Quellen: Plastics Europe/Greenpeace/DUH/BDE/FEAD