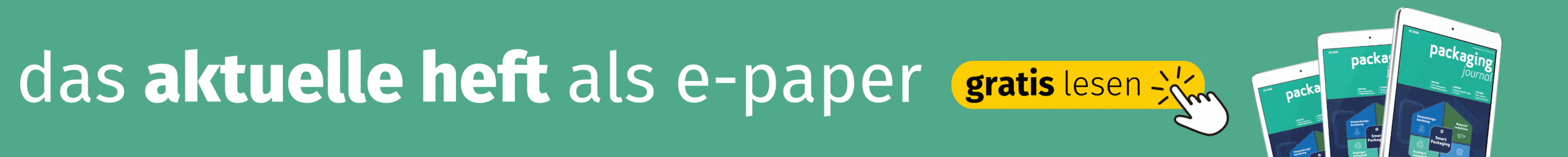Ein Research-Report des Retail Institute (Leeds Business School) bündelt die Sicht führender FMCG- und Verpackungsakteure und skizziert, wie die Branche bis 2034 Kreislaufwirtschaft, verlässliche Standards und faktenbasierte Regulierung vorantreiben soll. Die Autor:innen Ben Mitchell und Olga Munroe leiten daraus konkrete Handlungsempfehlungen für Industrie, Politik und Gesellschaft ab.
Die Studie betont, dass die Verpackungswirtschaft nicht auf politische Alleingänge warten dürfe, sondern selbst Systemlösungen entwickeln müsse – von nationaler Selbstversorgung bei Sekundärrohstoffen bis zu lokalisierten Lieferketten und der gemeinsamen Entwicklung wiederverwendbarer Formate. Empfehlungen adressieren eine branchenweite Abstimmung von Materialien, klare LCA-Leitplanken, die Bekämpfung von Greenwashing sowie koordiniertes Stakeholder-Storytelling, das Vertrauen zurückgewinnt.
Empfehlungen im Überblick
Auf Systemebene fordert der Bericht industriegetriebene Kreislauflösungen, die Entwicklung inländischer Verarbeitungs- und Recyclingkapazitäten und die Vereinfachung von Packformaten zugunsten sortenreiner, sammel- und recycelgerechter Monomaterialien. Parallel sollen Best-Practice-Reuse-Modelle skaliert und entlang der Wertschöpfungskette harmonisiert werden. Für die Kommunikation verlangt die Gruppe eine übergreifende, vertrauensbildende Ansprache von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und NGOs – möglichst getragen von einer glaubwürdigen Branchenstimme –, um konsistente Ziele und Fortschritte zu vermitteln.
Politik, Standards und Finanzierung
Die Autor:innen plädieren für staatlich angeleitete Standardisierung, einheitliche LCA-Vorgaben, konsistente haushaltsnahe Sammlungen und gezielte Investitionen in Sortier- und Recyclingtechnologien, einschließlich fortgeschrittener Verfahren, wo sie ökologisch belegt sind. EPR-Mittel sollen zweckgebunden in Infrastruktur fließen; zugleich braucht es Regeln gegen irreführende Umweltwerbung, um Vertrauen zu stärken. In einem Umfeld geopolitischer Unsicherheit rückt nationale Resilienz in der Materialversorgung in den Fokus; hier könne eine klare Material-Roadmap mit fiskalischen Anreizen Forschung und Markthochlauf lenken.
Verbraucher, Evidenz und Vertrauen
Ein wiederkehrendes Motiv ist die Lücke zwischen öffentlicher Wahrnehmung und systemischer Realität. Die Gruppe beobachtet Frustration, Skepsis gegenüber Recyclingwegen und wachsende Sensibilität für Greenwashing. Der Bericht fordert daher unabhängige, empirisch belastbare Evidenz als Grundlage für Design- und Regulierungsentscheidungen sowie für eine nüchterne Verbraucherkommunikation, die Zielkonflikte – etwa CO₂-Bilanz vs. Produktschutz – transparent macht. Empfohlen werden Bildungsinitiativen, DRS-Einführungen und kooperative Kampagnen von Industrie, NGOs, Kommunen und Hochschulen.
Technologie, Reuse und Skalierung
Technologie gilt als Hebel, um Sortierqualität, Controlling und Konsumenten-Incentives zu verbessern – von automatisierter Erkennung über digitale Rücknahmelogiken bis zu KI-gestützter Datenanalyse. Reuse- und Refill-Modelle haben Potenzial, benötigen aber Zeit, Investitionen, gemeinsame Infrastruktur und verlässliche Governance, damit Rücklaufquoten, Hygienestandards und Logistik ökologisch und wirtschaftlich tragen. Fallbeispiele wie standardisierte Mehrweg-Transportlösungen oder B2B-Nachfüllsysteme illustrieren, dass Kooperation, Daten und Durchsetzungsmechanismen entscheidend sind.
Einordnung für Verpacker und Retail
Für Verpackungshersteller und Händler leitet der Report einen klaren Fahrplan ab: strategische Langfristplanung mit Fehlertoleranz, systemische Partnerschaften statt Silo-Optimierung, kohärente Scope-1/2/3-Strategien und konsequente Umstellung auf standardisierte, kreislaufgerechte Materialportfolios. Gelingt der Schulterschluss, erwartet die Gruppe steigende Verfügbarkeiten hochwertiger Sekundärrohstoffe, Skaleneffekte, verlässlichere CO₂-Daten – und eine belastbare Grundlage für kommende Regulierungsmeilensteine.
Quelle: Leeds Beckett University